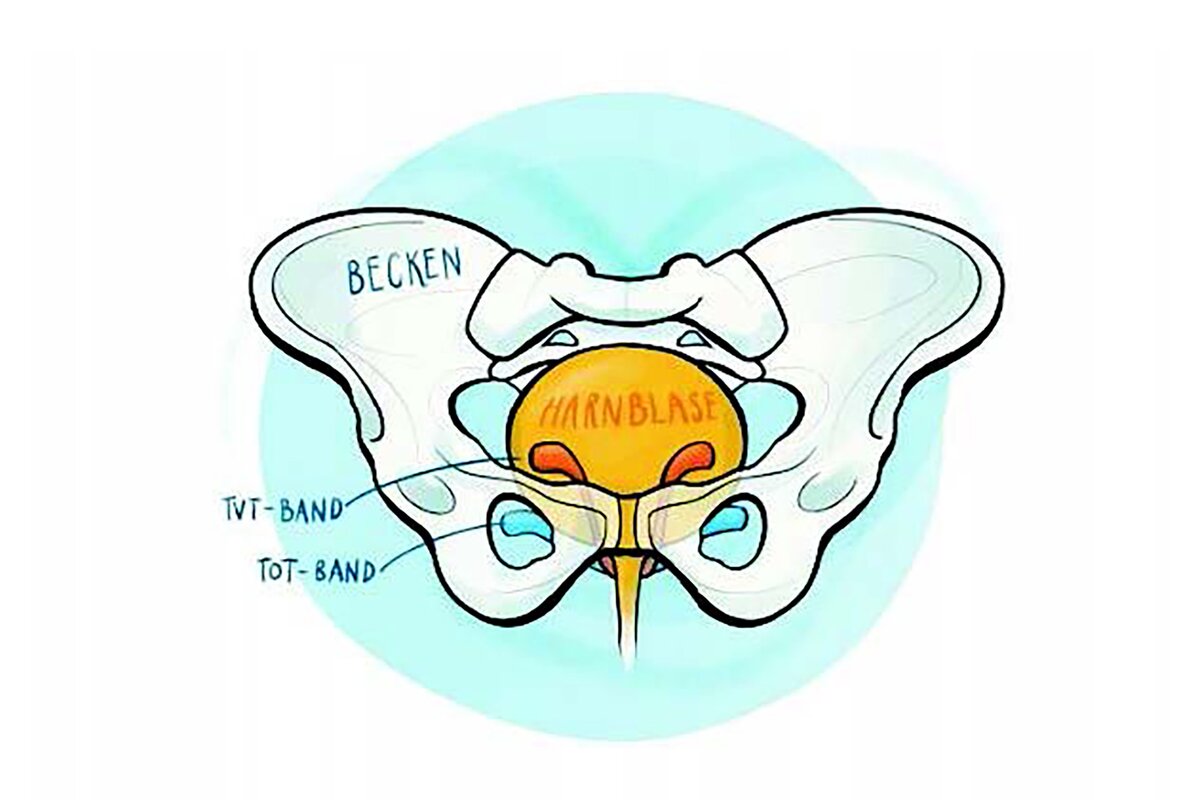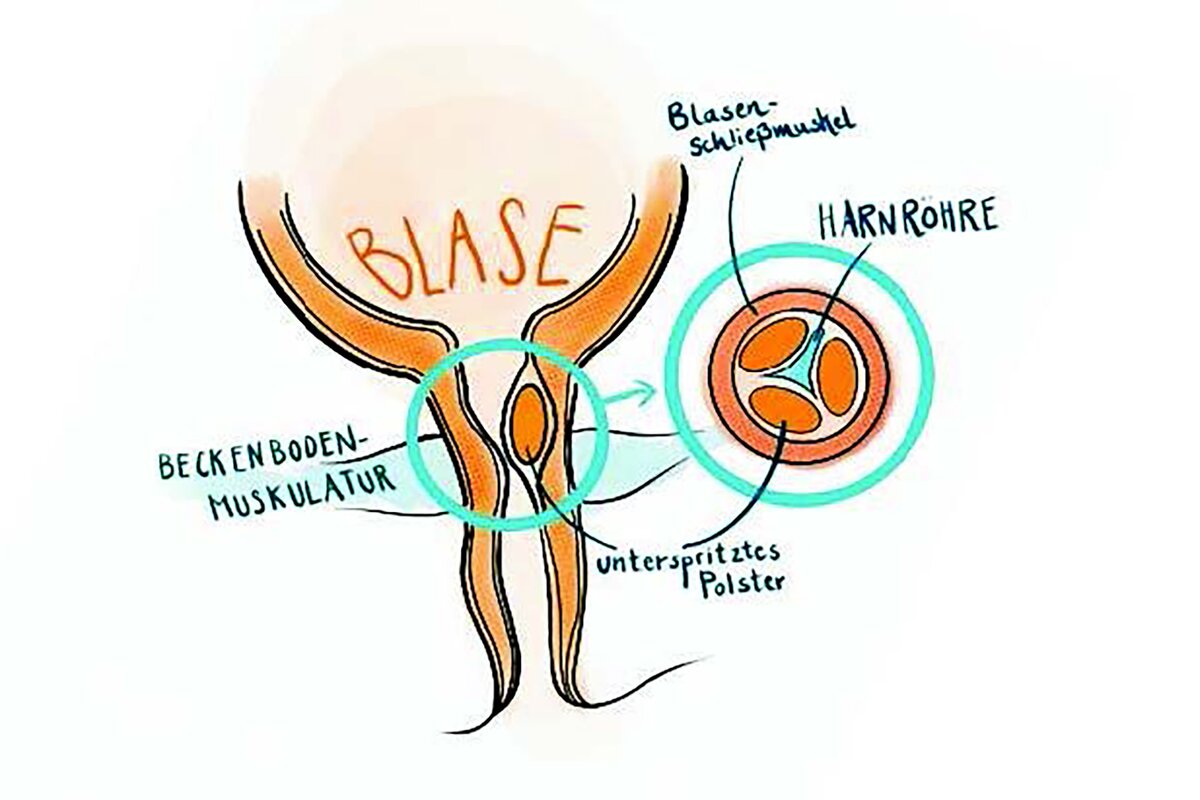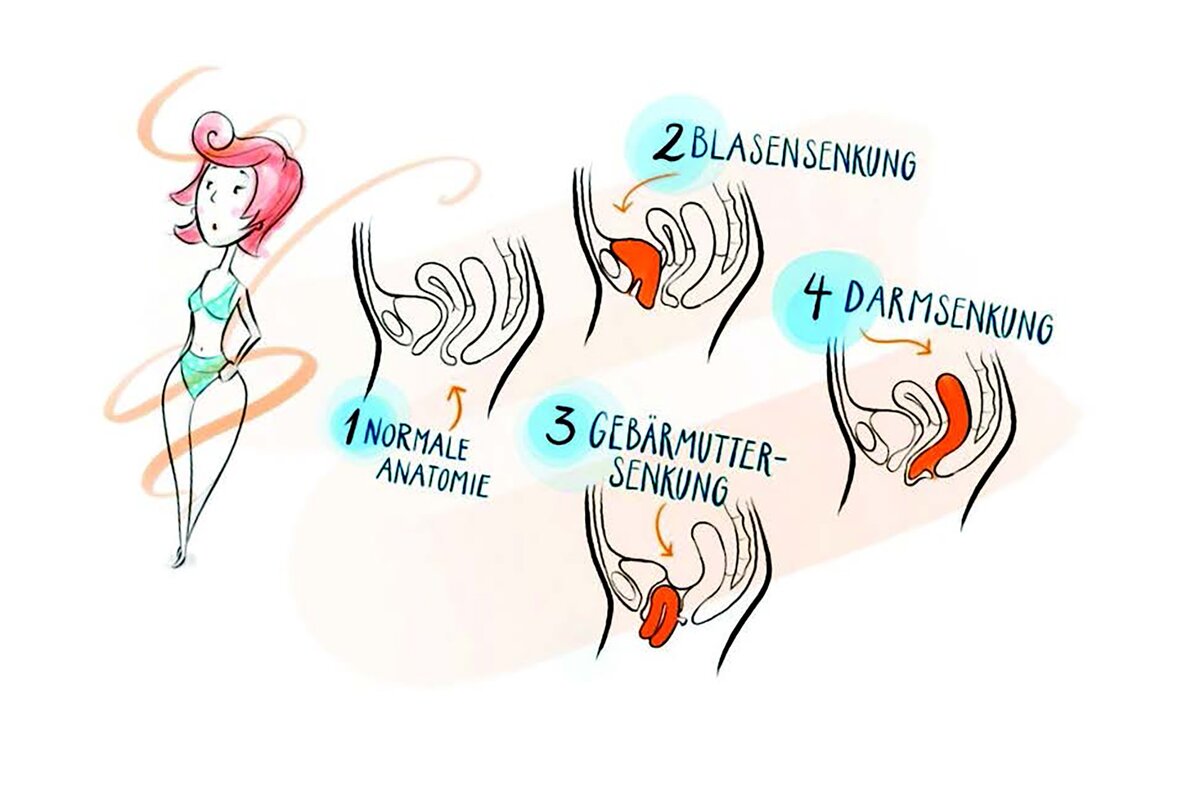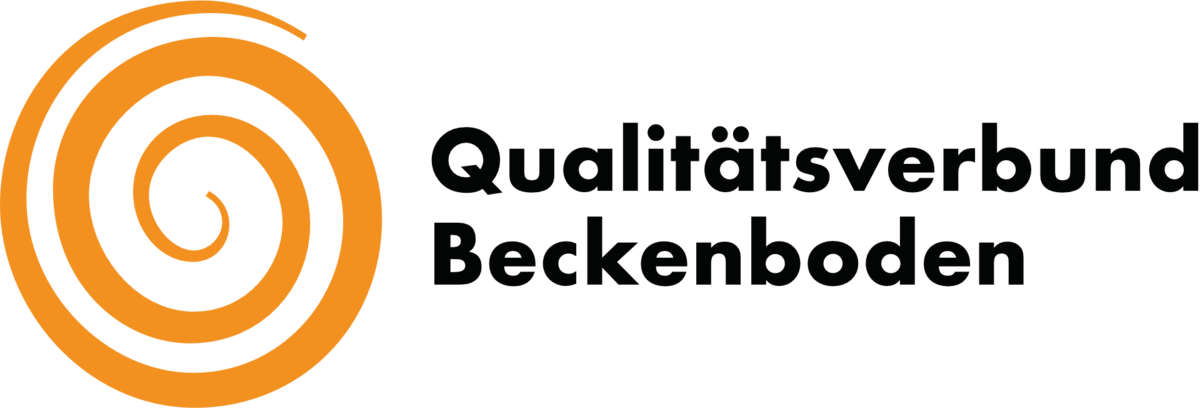Herzlich willkommen in unserer Abteilung für Urogynäkologie und Beckenbodengesundheit. Wenn Sie mit Problemen wie Inkontinenz, Beckenbodenschwäche oder anderen Beschwerden konfrontiert sind, lassen wir Sie nicht allein. Die Gynäkologie im Josefinum steht dafür, Frauen mit Einfühlungsvermögen, Fachkompetenz und innovativen Behandlungsmethoden zu helfen.
Unser Team aus qualifizierten Fachärztinnen und Fachärzten verfügt über umfassende Erfahrung und Expertise in der Diagnostik und Behandlung von urogynäkologischen Problemen. Wir wissen, wie belastend und einschränkend diese Beschwerden sein können und setzen uns dafür ein, Ihnen eine individuelle Behandlung anzubieten, die auf Ihre Bedürfnisse und Lebensumstände abgestimmt ist. Wir bieten Ihnen einen sicheren Raum, in dem Sie sich verstanden fühlen und Ihre Fragen und Bedenken offen ansprechen können.